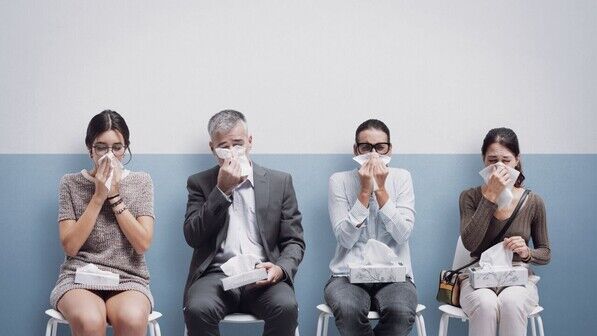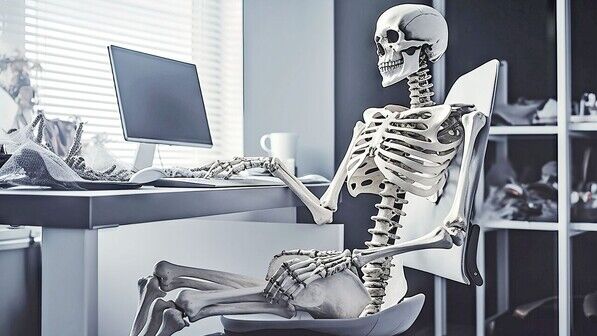So viel ist klar: Ist ein Arbeitnehmer krank, darf er zu Hause bleiben und wird weiterbezahlt. Aber was ist, wenn nicht die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter erkrankt, sondern dessen Kind? Leonie Pilz, Referentin für Arbeitsrecht und Tarifpolitik bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), erklärt, was es zu beachten gilt.
Dürfen Arbeitnehmer zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist?
Ja. Laut Expertin Pilz sei der Arbeitgeber verpflichtet, die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter freizustellen, wenn ein Kind unter zwölf Jahren erkranke. Der Chef dürfe auch nicht verlangen, dass Arbeitnehmer ihre Überstunden oder Zeitguthaben dafür aufbrauchten. Allerdings gilt: Erkrankt das Kind während des Urlaubs, besteht kein Anspruch, die Urlaubstage nachzuholen.
Zahlt der Arbeitgeber den Lohn während der Freistellung weiter?
Das hängt von den Vereinbarungen ab. „Im Arbeitsvertrag kann dies durchaus ausgeschlossen werden“, sagt Leonie Pilz. Sei die bezahlte Freistellung vom Dienst hingegen vertraglich vereinbart, komme es auf die Art der Beschäftigung an, wie lange der Arbeitgeber zahlen müsse. Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst etwa seien bei der Erkrankung eines Kindes bis zum zwölften Lebensjahr bis zu vier Pflegetage pro Jahr vorgesehen, sollte keine andere Betreuung organisiert werden können. Stehe im Arbeitsvertrag gar nichts zu diesem Thema, müsse der Arbeitgeber zwar ebenfalls den Mitarbeiter freistellen und bezahlen. Eine eindeutige Regelung über den zulässigen Zeitraum gebe es in diesem Fall aber nicht. Die Rechtsprechung habe jedoch als verhältnismäßig beziehungsweise „nicht erheblich“ einen Zeitraum von bis zu fünf Tagen pro Jahr festgestellt, so die Wirtschaftsjuristin.
Lesen Sie auch auf aktiv-online.de wann der Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung leisten muss.
Der Arbeitgeber zahlt den Lohn nur fünf Tage weiter, das Kind ist aber länger pflegebedürftig. Was nun?
Wenn der Arbeitgeber nicht mehr zahlt oder die Zahlung im Arbeitsvertrag ausgeschlossen ist, können gesetzlich Versicherte das sogenannte Kinderkrankengeld von der Krankenkasse in Anspruch nehmen. Bei Privatversicherten komme es auf die Police an, so Leonie Pilz: „Private Krankenkassen zahlen nicht automatisch.“ Entscheidend sei jedoch, wie das Kind versichert sei. Die Versicherung der Eltern spiele keine Rolle.
Wie lange wird das Kinderkrankengeld gezahlt?
Für 2024 und 2025 gilt: Das Kinderkrankengeld wird bis zu 15 Tage im Jahr pro Kind und Elternteil gezahlt, für Alleinerziehende 30 Tage. Bei mehreren Kindern steigt die Zahl auf maximal 35 Arbeitstage pro Elternteil beziehungsweise 70 Tage für Alleinerziehende. Welcher Elternteil sich freistellen lässt, können laut Leonie Pilz die Eltern selbst entscheiden.
Kinderkrankengeld: Höhe ist gedeckelt
Gezahlt werden 90 Prozent des Nettoverdienstes, der Betrag ist aktuell jedoch auf 120,75 Euro pro Tag gedeckelt. Selbstständige bekommen 70 Prozent ihres täglichen Arbeitseinkommens. Diese Regeln gelten nach BDA-Angaben sowohl für gesetzliche als auch private Krankenversicherungen. Kinderkrankengeld sei generell steuerfrei, werde aber auf das zu versteuernde Einkommen hinzugerechnet, sodass sich der Steuersatz erhöhen könne.
Können sich Eltern Kinderkrankentage gegenseitig übertragen?
Wenn ein Elternteil seinen Anspruch auf Kinderkrankengeld ausgeschöpft hat, dem anderen aber noch Tage zustehen, gibt es zwar keinen gesetzlichen Anspruch auf Übertragung: „Aber mit Einverständnis des Arbeitgebers ist das schon möglich“, sagt Expertin Pilz. Man sollte also in diesem Fall das Gespräch suchen.
Was muss unmittelbar passieren, wenn das Kind krank zu Hause betreut wird?
Der Arbeitnehmer muss sich vom Arzt ein Attest ausstellen lassen. Dieser „Kinderkrankenschein“ muss schnellstmöglich sowohl der Krankenkasse als auch in Kopie dem Arbeitgeber weitergeleitet werden. „Dies ist gleichzeitig auch der Nachweis gegenüber dem Arbeitgeber, dass der Mitarbeiter als Betreuungsperson gebraucht wird und keine andere Person die Betreuung übernehmen kann“, sagt Pilz. Bei einem Unfall in der Schule oder im Kindergarten oder auf dem Weg dorthin zahle übrigens die gesetzliche Unfallversicherung das sogenannte Verletztengeld in Höhe von 80 Prozent des Bruttoentgelts.
Noch bis Ende Juni 2024 gelte eine Sonderregelung, die danach aber voraussichtlich fortgeführt werde: Demnach können Kinder auch telefonisch vom Arzt krankgeschrieben werden, wenn es keine Möglichkeit für ein Videogespräch gibt. Die telefonische Krankschreibung für das Kind ist auf maximal fünf Tage begrenzt, außerdem muss das Kind der Praxis bereits persönlich bekannt sein, und es darf sich nur um eine leichte Erkrankung handeln. „Die telefonische Diagnose ist natürlich eine Entlastung“, so Pilz. Allerdings werde das Attest für Kinder noch immer in Papierform ausgestellt und müsse daher zumeist persönlich in der Arztpraxis abgeholt werden.
Dürfen Eltern sofort den Arbeitsplatz verlassen, wenn das Kind krank ist?
Da es einen Anspruch auf Freistellung gebe, dürften Eltern auch sofort ihre Arbeit unterbrechen, so die Expertin. Allerdings sollten sie abwägen, ob es sich um einen dringenden Fall handelt oder ob die Betreuung zunächst auch anderweitig geregelt werden könne. Auf jeden Fall sollte der Chef sofort persönlich, telefonisch oder per E-Mail informiert werden und ihm auch schnellstmöglich das ärztliche Attest vorgelegt werden: „Damit er weiß, wie lange er mit dem Ausfall rechnen muss.“
Darf der Arbeitgeber verlangen, Behandlungen des Kindes mit anschließender Pflege zu verschieben, etwa eine Operation?
Nein, zumindest nicht bei medizinisch notwendigen Behandlungen, so die Expertin. Ob eine Verschiebung in Betracht komme, etwa weil gerade im Unternehmen ein wichtiges Projekt anstehe, liege allein im Ermessen der behandelnden Ärzte.

Nach seinem Germanistik-Studium in Siegen und Köln arbeitete Tobias Christ als Redakteur und Pauschalist bei Tageszeitungen wie der „Siegener Zeitung“ oder dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Derzeit schreibt er als freier Journalist Beiträge für Print- oder Onlinemedien. Für aktiv recherchiert er vor allem Ratgeberartikel, etwa rund um die Themen Mobilität und Arbeitsrecht. Privat wandert der Kölner gern oder treibt sich auf Oldtimermessen herum.
Alle Beiträge des Autors