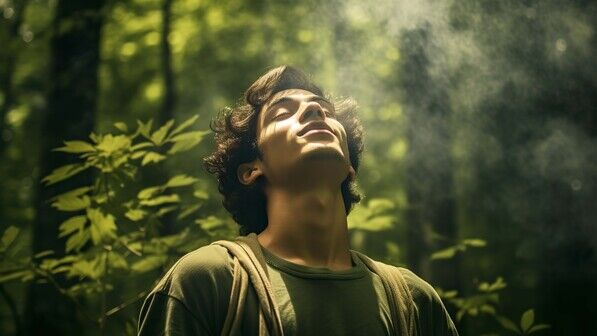Wer hierzulande krank wird, ist finanziell gut abgesichert, sobald er länger als vier Wochen in derselben Firma arbeitet. In den ersten sechs Krankheitswochen läuft das Gehalt zu 100 Prozent weiter, erst danach muss man sich mit dem geringeren Krankengeld begnügen. Trotzdem ist eine Krankschreibung keine Gehaltsgarantie. Daran hat sich auch seit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung („eAU“) nichts geändert.
Was viele nicht wissen: Im Entgeltfortzahlungsgesetz steht ausdrücklich, dass der Arbeitgeber nur zahlen muss, wenn ein Beschäftigter arbeitsunfähig wird, „ohne dass ihn ein Verschulden trifft“. Wer selbst schuld an seiner Erkrankung ist, bekommt auch mit Krankschreibung kein Gehalt mehr. Meist gibt es dann nur noch das geringere Krankengeld. In besonders krassen Fällen kann aber auch die Krankenkasse die Zahlung verweigern, beispielsweise bei Straftaten.
Für eigenes Verschulden reicht Unvorsichtigkeit nicht aus
Nur, was heißt „eigenes Verschulden“ eigentlich? Ist man selbst schuld an einer fiebrigen Erkältung, weil man sich nicht ausreichend vor Ansteckung geschützt hat? „Nein, es geht im Gesetz nicht um die ganz normalen alltäglichen Dinge, auch wenn man vielleicht mal etwas unvorsichtig war“, beruhigt Tabea Benz, Rechtsanwältin und Senior Adviser der Abteilung Arbeitsrecht und Tarifpolitik bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
Gemeint sind vielmehr Fälle, in denen jemand extrem leichtfertig die eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt oder sich sogar absichtlich selbst verletzt hat. „Es handelt sich um Ausnahmefälle, die immer individuell nach den konkreten Umständen des Einzelfalls geprüft werden müssen“, sagt die Arbeitsrechtlerin. Wann das möglicherweise der Fall sein könnte, erläutert die Rechtsexpertin anhand von verschiedenen Beispielen.
Wer Unfallverhütungsvorschriften missachtet, gefährdet seine Entgeltfortzahlung
Auch wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ganz offensichtlich selbst schuld an einem Arbeitsunfall ist, muss das Gehalt normalerweise trotzdem weiter gezahlt werden. „Die Entgeltfortzahlung ist nur dann gefährdet, wenn der oder die Beschäftigte sich trotz ausdrücklicher Anweisung des Vorgesetzten nicht an die Unfallverhütungsvorschriften gehalten hat“, erklärt Tabea Benz. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn jemand völlig betrunken und ohne Helm von einem Baugerüst herunterfällt, sich verletzt und deshalb krankgeschrieben wird.
Klar, dass der Betrieb die vorgeschriebene Schutzausrüstung zur Verfügung stellen muss. Gibt es keine, kann der Mitarbeiter bzw. die und Mitarbeiterin die Sicherheitsvorschriften ja nicht einhalten, und damit ist die Krankschreibung logischerweise auch nicht selbst verschuldet.
Arbeitsunfälle im Nebenjob können sich auf gesamte Lohnfortzahlung auswirken
Manche Beschäftigte haben einen Nebenjob, um sich ihr Gehalt aufzubessern. Wer dabei nicht aufpasst, gefährdet die gesamte Lohnfortzahlung, sowohl im Haupt- wie auch im Nebenjob. „Grundsätzlich dürfen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen insgesamt maximal zehn Stunden pro Tag arbeiten. Dabei werden alle Tätigkeiten zusammengezählt“, sagt Benz. Das steht ganz klar im Arbeitszeitgesetz. Wer einen normalen Acht-Stunden-Tag hat, darf hinterher also höchstens noch zwei Stunden woanders arbeiten.
Wenn man beispielsweise nach einem vollen Arbeitstag abends noch vier Stunden in einem Supermarkt Regale einräumt, hat der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin damit aus juristischer Sicht bewusst gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen. „Wenn dann etwas passiert, gibt es unter Umständen keine Lohnfortzahlung“, sagt die Juristin.
Beim Sport jeweilige Schutzvorschriften beachten
Einerseits ist Sport bekanntlich gesund, auf der anderen Seite kann man sich beim Training auch mal verletzen. Klar, dass das Verletzungsrisiko von der Sportart abhängt. Die meisten finden zum Beispiel Fallschirmspringen wesentlich riskanter als Walking im Park. Deshalb hat man früher Beschäftigten nur bei gefährlichen Sportarten ein Verschulden unterstellt. Doch vor Gericht hat dies oft nicht funktioniert. Es gab nämlich Richter bzw. Richterinnen, die beispielsweise Drachenfliegen, Amateurboxen oder Motorradrennen als „ungefährliche Sportarten“ eingestuft haben.
Wonach geht es also dann? „Die Entgeltfortzahlung kann gefährdet sein, wenn man die allgemein üblichen Schutzvorschriften der jeweiligen Sportart missachtet hat“, erläutert Benz. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn jemand ohne Helm Motorrad fährt oder bewusst ein Fahrrad mit defekten Bremsen benutzt. Rad fahren ohne Helm dagegen ist kein Problem, da es keine Helmpflicht für Fahrradfahrer gibt und folglich auch keine Schutzvorschrift verletzt wurde.
„Außerdem könnte die Entgeltfortzahlung versagt werden, wenn jemand eine Sportart weit jenseits der eigenen Fähigkeiten ausübt“, sagt die BDA-Juristin. Das wäre zum Beispiel gegeben, wenn ein absoluter Ski-Neuling eine „schwarze Piste“ herunterfährt, dabei stürzt und sich das Bein bricht.
Bei Verkehrsunfällen steht die Fortzahlung nur in Ausnahmefällen auf der Kippe
„Auch wenn Beschäftigte selbst schuld an einem Verkehrsunfall sind, gefährdet dies nur in Ausnahmefällen die Entgeltfortzahlung“, sagt Benz. Nur wer krass gegen Vorschriften verstößt, beispielsweise betrunken Auto fährt oder bei Tempo 150 auf dem Smartphone seine E-Mails checkt, deshalb einen Unfall baut und anschließend krankgeschrieben ist, kann erstens kein Verständnis und zweitens erst recht kein Geld vom Unternehmen erwarten.
Suchterkrankungen gelten in der Regel nicht als selbst verschuldet
Egal ob Alkohol, Zigaretten, Tabletten oder gar illegale Drogen – alles, was süchtig machen kann, ist bekanntlich nicht gesund. Dabei geht es nicht nur darum, ob man unter Drogeneinfluss einen Unfall baut, sondern auch um Fälle, in denen der jahrelange Missbrauch den Körper kaputt gemacht hat, beispielsweise Lungenkrebs bei starken Rauchern oder Leberzirrhose bei Alkoholikern. „Suchterkrankungen und auch Rückfälle gelten in der Rechtsprechung in der Regel nicht als selbst verschuldet“, sagt Tabea Benz. Wer aufgrund von suchtbedingten Erkrankungen nicht arbeiten kann, bekommt meist trotzdem die übliche Lohnfortzahlung. Eine Garantie ist das allerdings nicht, es gab in Einzelfällen auch immer mal wieder anderslautende Urteile.
Operationen müssen medizinisch notwendig sein
Nach medizinischen Eingriffen ist man häufig ein paar Tage krankgeschrieben, weil sich der Körper erholen muss. Im Normalfall läuft dann auch die Lohnfortzahlung weiter. Das gilt auch bei Organspenden, so steht es ausdrücklich in Paragraf 3a des Entgeltfortzahlungsgesetzes.
Anders ist es bei Kinderwunschbehandlungen, zum Beispiel bei Eingriffen zur Beseitigung der Unfruchtbarkeit oder bei künstlichen Befruchtungen. „Nach Einschätzung der Gerichte ist es Privatsache der Beschäftigten, ob sie sich Kinder wünschen oder nicht. Deshalb haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei einer Kinderwunschbehandlung grundsätzlich keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung“, erklärt BDA-Expertin Benz. Treten bei der Kinderwunschbehandlung jedoch nicht vorhersehbare Komplikationen auf, gilt das als unverschuldete Erkrankung und damit läuft die Lohnfortzahlung wieder.
Bei Schönheits-OPs kommt es auf den Grund für die Behandlung an. „Bei medizinisch notwendigen Eingriffen gibt es die übliche Entgeltfortzahlung“, so die Juristin. Ist beispielsweise eine Korrektur der Nasenscheidewand ärztlich angeordnet, weil jemand kaum noch Luft bekommt, gibt es also weiter Geld vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin. Dabei ist es egal, wenn dabei gleich noch die Nase hübscher gemacht wird.
Wer sich dagegen nur unters Messer legt, weil das eigene Spiegelbild nicht gefällt, muss auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verzichten. Nur wenn nicht vorhersehbare Komplikationen die Ausfallzeit in die Länge ziehen, läuft die Lohnfortzahlung wieder.
Wer eine Prügelei provoziert, riskiert die Lohnfortzahlung
Beschäftigte, die unverschuldet in eine Prügelei verwickelt wurden und anschließend krankgeschrieben sind, bekommen weiterhin ihr Gehalt. Das gilt selbst dann, wenn jemand sich in Gegenden bewegt, in denen Gewalt und Schlägereien zur Tagesordnung gehören, wo der Verletzte also mit einem Angriff rechnen musste. „Hat der Mitarbeiter die Tätlichkeiten jedoch provoziert oder sogar selbst damit angefangen, riskiert er damit nicht nur Verletzungen, sondern auch seine Entgeltfortzahlung“, weiß der BDA-Jurist.
Suizidversuche gelten in der Regel nicht als selbst verschuldet
Wer nicht mehr weiterleben will und sich deshalb selbst verletzt, dem wird normalerweise unterstellt, dass er bzw. sie zum Tatzeitpunkt nicht mehr voll bei Sinnen war. „Bei solchen Verzweiflungstaten wird den Betroffenen kein Schuldvorwurf gemacht und dementsprechend besteht in der Regel auch der übliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“, erklärt Benz.
Beweispflicht des Arbeitgebers
Wollen Vorgesetzte nicht zahlen, müssen sie beweisen können, dass dem erkrankten Mitarbeiter bzw. der erkrankten Mitarbeiterin ein Verschulden im Sinne des Gesetzes trifft. „Dabei müssen Beschäftigte aber mitwirken und zum Beispiel die notwendigen Auskünfte wahrheitsgemäß geben“, sagt die BDA-Juristin.
Wer findet, dass das alles den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin überhaupt nichts angeht und deshalb schweigt, bekommt dadurch automatisch die Schuld an der Erkrankung zugewiesen, und damit darf der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin die Lohnfortzahlung einstellen.
Silke Becker studierte Soziologie, BWL, Pädagogik und Philosophie. Seit ihrem Abschluss arbeitet sie als Redakteurin und freie Journalistin. Außerdem hat sie mehrere Bücher veröffentlicht. Am liebsten beschäftigt sie sich mit den Themen Geld, Recht, Immobilien, Rente und Pflege.
Alle Beiträge der Autorin