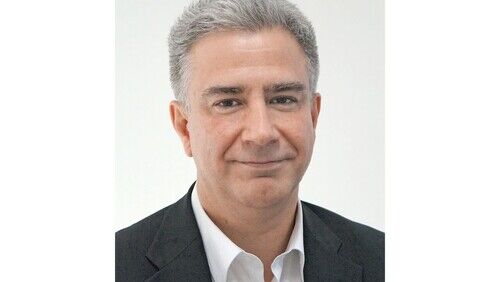Reiskirchen. Wie reagiert ein mit Wasserstoff angetriebenes Fahrzeug auf extreme Temperaturen, Feuchte oder hohen Druck? Was passiert, wenn es dauerhaft Erschütterungen oder Korrosion durch Salznebel ausgesetzt ist? Solche Fragen lassen sich durch modernste Prüftechnik beantworten, die die Reiskirchener Weiss Technik entwickelt und produziert.
Wasserstoff-Autos: Bestehende Testanlagen lassen sich nachrüsten
Das Unternehmen gehört zum Technologiekonzern Schunk Group in Heuchelheim mit rund 9.000 Beschäftigten weltweit und bietet zuverlässige Klimalösungen überall dort, wo optimale oder auch ganz besondere klimatische Rahmenbedingungen für Mensch und Maschine gefordert sind.
Sie kommen zum Einsatz bei industriellen Fertigungsprozessen, in Krankenhäusern oder eben auch in speziellen Testeinrichtungen zum Beispiel für Fahrzeuge. „Da Wasserstoffautos und deren Komponenten die gleichen Umweltsimulationstests bestehen müssen wie konventionelle Kraftfahrzeuge mit Verbrennungs- oder Elektromotor, entwickeln wir nun auch dafür entsprechende Prüfanlagen“, erklärt Jörg Ruppert, technischer Vertriebsleiter des Geschäftsfelds Anlagen bei Weiss Technik.
Neben der allgemein gestiegenen Nachfrage verzeichnet er auch viele Anfragen, um bereits bestehende Testanlagen für Wasserstoffanwendungen nachzurüsten.
Im chinesischen Tianjin hat Weiss Technik nun die weltweit erste Klima- und Leistungsprüfkammer für Wasserstoffautos gebaut: mit integrierter Sonnensimulation und einzigartiger Sicherheitsausstattung. 27 Speziallampen erzeugen eine Strahlenintensität und Lufterwärmung, die einem wolkenlosen Mittag in einer Wüste gleicht.
Um das Personal während der Tests vor eventuell austretendem Wasserstoff oder auch einem Explosionsrisiko zu schützen, wurde eine eigene Sicherheitsausstattung entwickelt. „Wasserstoff reagiert leicht mit Sauerstoff, ist also zündfreudig und hochexplosiv, und genau darauf muss man sich bei allen Tests einstellen“, erklärt Ingenieur Ruppert.
Prüfkammer mit speziellem Sicherheitskonzept
Also orientierten sich die Konstrukteure unter anderem an den EU-Sicherheitsvorgaben für explosionsgefährdete Bereiche inklusive Schutzvorrichtungen wie Abdeckungen sowie Sensoren zur Gasmessung. Zudem wurden die Leuchten so installiert, dass sie keine Zündquelle für den Wasserstoff darstellen. Ruppert: „Dieses spezielle Sicherheitskonzept macht diese Prüfkammer zur ersten ihrer Art – weltweit.“

Maja Becker-Mohr ist für aktiv in den Unternehmen der hessischen Metall-, Elektro- und IT-Industrie sowie der papier- und kunststoffverarbeitenden Industrie unterwegs. Die Diplom-Meteorologin entdeckte ihr Herz für Wirtschaftsthemen als Redakteurin bei den VDI-Nachrichten in Düsseldorf, was sich bei ihr als Kommunikationschefin beim Arbeitgeberverband Hessenchemie noch vertiefte. In der Freizeit streift sie am liebsten durch Wald, Feld und Flur.
Alle Beiträge der Autorin