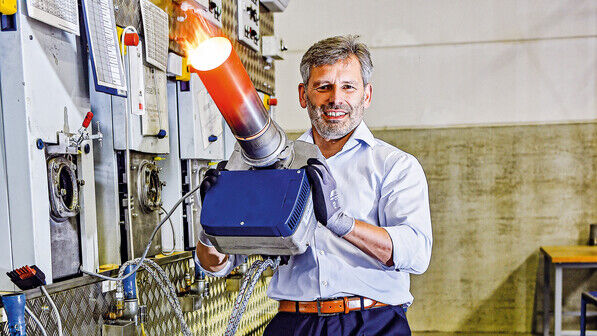Köln. Die Heizungswende in den Kellern kommt in Fahrt: 306.500 neue Heizgeräte wurden im ersten Quartal 2023 verkauft – das waren fast 40 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahrs. Bei Wärmepumpen verdoppelte sich im selben Zeitraum der Absatz auf fast 97.000 Geräte. Zudem wurden 168.000 Gaskessel eingebaut.
Jede neue Heizung mit erneuerbaren Energien ist wichtig. Denn ohne bessere Heiztechnik kann Deutschland nicht klimaneutral werden. Deshalb will die Bundesregierung mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz vom Jahr 2024 an den Einbau von Wärmepumpen und den Umstieg auf Fernwärme forcieren.
Schon jetzt gibt der Staat über die „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ beim Einbau neuer Heiztechnik kräftig Anschub: 25, 30, in der Spitze 40 Prozent Förderung können Verbraucher für neue Heiztechnik ergattern! Allerdings nicht für einen neuen Gaskessel!
Heizungsförderung unbedingt vor Auftragsvergabe beantragen
Ganz wichtig für die Förderung: „Erst beantragen, dann beauftragen!“, erklärt Stefan Materne, Experte bei der Energieberatung der Verbraucherzentralen. „Am besten holt man mehrere Angebote ein, um mehr Kostensicherheit zu bekommen. Mit den Werten des bevorzugten Angebots stellt man dann den Antrag“, erklärt Materne. Das macht man auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft (Bafa) über ein elektronisches Antragsformular: bafa.de
Danach kann man den Handwerker oder das Fachunternehmen beauftragen. Dort muss man mit einer mehrwöchigen Wartezeit rechnen. Aktuell mehrere Wochen dauert es auch, bis der Bescheid vom Bafa kommt. Wer vorher mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen will, kann das tun. Das Bafa betont aber: „Wird mit der Maßnahme NACH Antragstellung und VOR Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen, erfolgt dies auf eigenes Risiko, da gegebenenfalls nicht förderfähige Maßnahmen umgesetzt werden.“ Ausgezahlt wird die Förderung, wenn die Heizung installiert ist und Rechnungen sowie Verwendungsnachweise eingereicht wurden.
So viel Förderung pro Heizungstyp ist jetzt drin
Und was geht nun beim Heizen? Zu welchen Preisen? Und mit welcher Förderung? Die Antworten pro Heizungstyp lesen Sie im Folgenden:
1. Gas-Brennwert-Kessel: Keine Förderung!
- Er ist eine auslaufende Technik. Im Jahr 2023 darf man noch eine neue Gasheizung einbauen. Ab 2024 ist sie im Neubau tabu – und im Altbau nur noch erlaubt, wenn noch keine kommunale Wärmeplanung vorliegt und das Gerät wasserstofftauglich ist, Biomethan oder biogenes Flüssiggas nutzt.
- Einen neuen Gaskessel hält Materne trotzdem für „keine gute Idee: Denn Heizen mit Gas wird in Zukunft durch die steigende CO2-Bepreisung sowie ab 2027 durch den europäischen Emissionshandel massiv teurer werden. Zudem werden fossile Heizungen ab 2045 auch im Bestand verboten.“ Und grünen Wasserstoff werde es auf absehbare Zeit nicht in ausreichenden Mengen geben, sagt Materne. Der zukünftige Preis sei derzeit nicht abzuschätzen.
- Für einen neuen Gas-Brennwert-Kessel zahlt man aktuell 15.000 Euro.
2. Heizen mit Biomasse: Förderung nur bei Kombi-Anlage!
- Pellets, Holzhackschnitzel und Stückholz gelten als erneuerbare Energien, setzen aber beim Verbrennen gefährlichen Feinstaub frei. Die Geräte müssen deshalb strenge Emissionsgrenzwerte einhalten. Zudem ist nachhaltig erzeugte Biomasse nur begrenzt verfügbar. Deshalb fördert die Regierung Biomasse-Heizungen aktuell mit 10 Prozent nur in Verbindung mit Solarkollektoren oder Wärmepumpe. Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz wird es voraussichtlich mehr Förderung geben. Interessenten sollten also warten.
- Hinweis: Biomasseheizungen benötigen einen großen Heißwasserspeicher und Platz zum Lagern von Pellets oder Hackschnitzeln.
- Ein Pellet-Kessel kostet 37.000 Euro, ein Holzhackschnitzel-Kessel 42.000 Euro.
3. Luft-Wärmepumpe: 25 bis 30 Prozent Förderung
- Diese Geräte dürften zukünftig zur Standard-Heizung werden. Die preiswerteste Variante, die Luft-Wärmepumpe, gewinnt die zum Heizen nötige Energie über einen Ventilator aus der Umgebungsluft. „Wichtig ist, dass das Gerät in der Bafa-Liste ‚Pumpen mit Effizienznachweis‘ aufgeführt ist“, betont Materne. „Nur dann gibt es Förderung.“
- Tipp: Auf die Jahresarbeitszahl achten und dafür einen Wärmemengenzähler einbauen! Je höher sie ist, desto billiger arbeitet die Pumpe. Ein Wert von drei sollte es mindestens sein. Und: Fragen Sie nach dem Geräuschpegel! Damit sich nach dem Einbau nicht die Nachbarn beschweren.
- 30 Prozent statt normal 25 Prozent Förderung gibt es für Geräte, die mit einem natürlichen Kältemittel wie etwa Propan arbeiten.
- Für eine Luft-Wärmepumpe investiert man 31.000 Euro.
4. Erd-Wärmepumpe: 30 Prozent Förderung
- Die Energie zum Heizen kann eine Wärmepumpe auch aus der Erde beziehen. Dafür werden 1,50 Meter tief im Boden Flächenkollektoren verlegt. Oder es wird in bis zu 200 Meter Tiefe eine Erdwärme-Sonde platziert. Diese Technik bewährt sich laut dem Fraunhofer Institut ISE (mit Jahresarbeitszahlen von im Schnitt 4,1) besonders bei Altbauten. Auch diese Geräte müssen auf der Bafa-Liste zur Effizienz stehen. Der Einsatz eines natürlichen Kältemittels wird hier nicht extra gefördert.
- Eine Erd-Wärmepumpe mit Kollektoren kostet 44.000 Euro, eine mit Sonden 48.000 Euro.
5. Fernwärme: 30 Prozent Förderung
- Laut Gebäudeenergiegesetz sollen bis spätestens im Jahr 2028 alle Städte und Gemeinden eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Da ergeben sich womöglich neue Perspektiven für manche Hausbesitzer. Wer sein Heim an ein städtisches Wärmenetz oder ein Fernwärmenetz anschließt, erhält Förderung für die Wärmeübergabestation – vorausgesetzt, die Wärme wird zu mindestens 25 Prozent mit erneuerbaren Energien erzeugt.
- Für die Anschlusstechnik muss man aktuell 5.000 bis 15.000 Euro zahlen.
6. Solarkollektoren: 25 Prozent Förderung
- Legt man sich Kollektoren aufs Dach, kann man mit Sonnenenergie Wasser erwärmen, speichern und die Heizung unterstützen. Bei einem Einfamilienhaus sind – je nach Wasserverbrauch – vier bis zehn Quadratmeter Fläche üblich. Tipp: Zur Effizienzkontrolle sollten diese unbedingt mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet werden.
- Solarkollektoren bekommt man je nach Größe für 8.000 bis 14.000 Euro.
Bonusförderung: Wer früh umsteigt, den belohnt das Leben
Noch mal 10 Prozentpunkte mehr Zuschuss heimst ein, wer eine funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gas- oder Nachtspeicher-Heizung durch eine neue effizientere und klimaschonende Anlage ersetzt; eine Gasheizung muss dazu aber mindestens 20 Jahre alt sein. Für die Frühwechsler sind maximal folgende Fördersätze möglich:
- Luft-Wärmepumpe: 35 bis 40 Prozent
- Erd-Wärmepumpe: 40 Prozent
- Fernwärme: 40 Prozent
Zum Verständnis: Bei den angegebenen Preisen handelt es sich, so unser Experte, um bundesweite Durchschnittspreise. Sie umfassen die Investition in eine neue Heizung inklusive Demontage und Entsorgung des alten Kessels, aber NICHT eine neue Flächenheizung, Heizkörper, Steig- und Verteilleitungen.
Übrigens: Förderung erhält auch, wer seine Heizung ersetzen muss, weil sie über 30 Jahre alt ist. Und wer die Heizung ohne Förderung saniert: 20 Prozent der Kosten kann er beim selbst bewohnten Haus über drei Jahre von der Steuerschuld abziehen, insgesamt aber maximal 40.000 Euro.
Am besten lässt man sich beraten. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet einen „Eignungs-Check Heizung“ an. Experten finde man auch unter energie-effizienz-experten.de. Das Schöne dabei: Die Beratung wird gefördert.
Ölheizung: Diese Regeln gelten ab 2024
- Das wird verboten: Voraussichtlich von 2024 an dürfen Ölheizungen nicht mehr neu in Häusern installiert werden. So sieht es das geplante Gebäudeenergiegesetz vor.
- Das bleibt erlaubt: Bestehende Anlagen dürfen weiterlaufen. Hausbesitzer können auch in Zukunft mit einer Hybridanlage planen. Allerdings darf die Brennwert-Ölheizung nur als Spitzenlasterzeuger eingesetzt werden, wenn der Wärmebedarf nicht mehr von der Wärmepumpe gedeckt werden kann. Die Wärmepumpe muss mindestens 30 Prozent der Heizlast des von der Hybridheizung versorgten Gebäudes liefern.
- Austauschpflicht: Heizungen, die mehr als 30 Jahre alt sind, müssen laut Gesetz ausgetauscht werden.

Hans Joachim Wolter schreibt bei aktiv vor allem über Klimaschutz, Energiewende, Umwelt, Produktinnovationen sowie die Pharma- und Chemie-Industrie. Der studierte Apotheker und Journalist begann bei der Tageszeitung „Rheinpfalz“ in Ludwigshafen und wechselte dann zu einem Chemie-Fachmagazin in Frankfurt. Wenn er nicht im Internet nach Fakten gräbt, entspannt er bei Jazz-Musik, Fußballübertragungen oder in Kunstausstellungen.
Alle Beiträge des Autors